Eine geschwächte Scheidenflora ist eine der wesentlichen Scheidenpilz-Ursachen.
Scheidenpilz Ursachennicht nur eine, sondern viele
Die Ursachen für Vaginalpilzinfektionen sind verschieden. Sie reichen von einem geschwächten Immunsystem über eine gestörte Vaginalflora bis hin zu ungünstiger Kleidung. Was immer die Scheidenpilz-Ursache ist: Pilze mögen es warm und feucht, daher siedeln sie sich häufig im Intimbereich an. Hier erfahrt ihr mehr über die häufigsten Ursachen für Scheidenpilze und was ihr tun könnt, um euch erfolgreich zu schützen.
Worüber wir sprechen wollen

Was sind die Ursachen von Scheidenpilz?
Die gesunde Scheide beherbergt Millionen sogenannter scheidentypischer Bakterien. Bei der Frau im gebärfähigen Alter dominieren die Milchsäurebakterien (Laktobazillen) die Scheidenflora. Durch die Bildung von Milchsäure – daher ihr Name – sorgen sie für ein saures Milieu, in dem sich die meisten Bakterien oder Pilze nicht oder nur in harmloser Zahl wohlfühlen. Für die Laktobazillen selbst bietet das saure Milieu optimale Vermehrungsbedingungen, so dass diese in hoher Zahl in der Vagina siedeln und andere Keime erfolgreich verdrängen und eindämmen.
Laktobazillen bilden einen natürlichen Schutz vor Eindringlingen. Wird diese Schutzschicht jedoch beeinträchtigt, können unerwünschte Mikroorganismen, beispielsweise aus dem Enddarm oder der Haut, leichter die Oberhand gewinnen. Mit anderen Worten: Eine geschwächte Scheidenflora ist eine der wesentlichen Scheidenpilz-Ursachen.
Übrigens sind 75 Prozent aller Frauen mindestens einmal im Leben von einem Vaginalpilz betroffen, ihr seid mit eurem Problem also nicht allein!
Was nun kann das Milieu der Scheide beeinträchtigen und einem Scheidenpilz die Tür öffnen? Zu den hauptsächlichen Ursachen zählen:
- hormonelle Schwankungen – wie sie typischerweise in der Pubertät, in der Schwangerschaft, innerhalb des Zyklus und in den Wechseljahren vorkommen
- Immunschwäche
- die Einnahme von Medikamenten wie Antibiotika, Kortison oder Antibabypille
- Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes)
- falsche oder übertriebene Intimhygiene
- vitaminarme Ernährung und übermäßiger Stress
Hormone und Scheidenpilz: eine der Hauptursachen
Hormonelle Schwankungen beeinflussen bestimmte Stoffwechselprozesse, auch in den Zellen der Vaginalhaut. Während der Schwangerschaft, in den Wechseljahren und selbst im Verlauf des weiblichen Zyklus verändert sich die Östrogenmenge. Ist Östrogen nicht in ausreichendem Maß vorhanden, entsteht zu wenig Glykogen, ein wichtiger Mehrfachzucker, der in bestimmten Zellen der Vaginalhaut aktiv ist. Die Laktobazillen der Scheide brauchen das Glykogen, um Milchsäure daraus zu machen.

Kurzum: Milchsäurebakterien benötigen eine Art „Wohlfühlmilieu“, um sich optimal fortzupflanzen. Ohne ausreichend Milchsäurebakterien im Scheidenmilieu haben es Pilze oder andere Erreger leichter.
Deshalb kann Östrogen eine Ursache für Scheidenpilz sein. Ein Anstieg oder auch Schwanken des Östrogenspiegels ist in vielen Lebensphasen einer Frau vollkommen normal.
In den folgenden Lebensphasen kann das schon mal vorkommen:
- während der Pubertät
- während der Schwangerschaft
- während der Wechseljahre
- während einer Hormonersatztherapie
- gelegentlich unter Pilleneinnahme (je nach Dosierung)
Da auch die Pille oder eine Hormonersatztherapie in den Hormonhaushalt eingreift, können auch sie die vaginale Balance beeinträchtigen.
Scheidenpilz-Ursache in den Wechseljahren
Das psychische und körperliche „Auf und Ab“ der Wechseljahre empfinden viele Frauen als sehr anstrengend. Leider ist es keine Seltenheit, dass in dieser Zeit auch eine Scheidenpilzinfektion auftreten kann. Unregelmäßige Zyklen, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen: Viele Frauen spüren in den Wechseljahren sehr intensiv, dass sie sich in einer Phase des Umbruchs befinden. Auch das sensible Scheidenmilieu ist von den hormonellen Veränderungen im Körper betroffen: Mit den Schwankungen im Hormonhaushalt ändern sich auch die Verhältnisse im Vaginalbereich. Scheidentrockenheit stellt sich ein, die Haut ist weniger gut durchblutet und deutlich empfindlicher.
Zu den typischen Begleiterscheinungen der Wechseljahre gehört auch eine deutlich spürbare Scheidentrockenheit (bedingt durch den Rückgang der Dicke des Gewebes und eine schlechtere Durchblutung). Leichte Reizungen können bereits zu kleinen Entzündungen führen. So wird Keimen die Ausbreitung im Scheidenmilieu erleichtert.
Scheidenpilz Ursachen: Krankheiten und ein schwaches Immunsystem
Auch Krankheiten oder Stoffwechselstörungen können das Risiko für einen Vaginalpilz erhöhen. Dazu zählen Diabetes mellitus, Schilddrüsenerkrankungen und allgemein alle Krankheiten, die das Immunsystem stark schwächen.
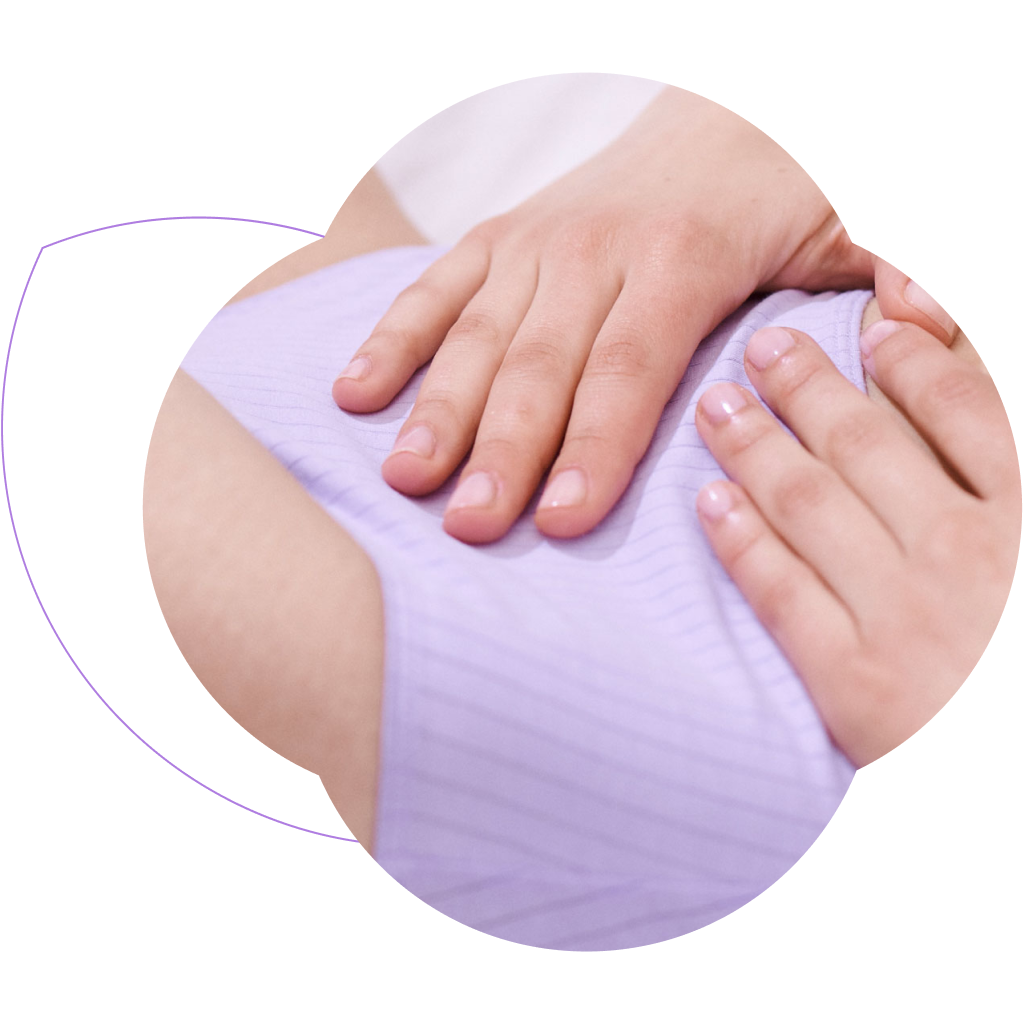
Nicht selten trifft Frauen eine Infektion mit Scheidenpilz, wenn sie sich ohnehin schon erschöpft und angeschlagen fühlen. Das ist kein Zufall – ein geschwächtes Immunsystem kann die Ursache für Scheidenpilz sein:
- bei ungewöhnlich hoher Arbeitsbelastung
- in emotionalen Ausnahmesituationen (Trennung, Trauer, Angst vor Job-Verlust)
- bei psychischen Problemen (Depression, Angstzuständen)
Nicht nur akute Krankheiten oder ein ungesunder Lebensstil schwächen das Immunsystem. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Abwehrkräfte auch sehr empfindlich auf jede Art von Stress reagieren. Zum Glück gibt es viele einfache Strategien, um das Immunsystem zu stabilisieren oder nach einem Durchhänger wieder auf Trab zu bringen. Schon kleine Änderungen der Gewohnheiten und im Tagesablauf können viel bewirken!
Scheidenpilz durch Medikamente
Nicht selten trifft Scheidenpilz auch Frauen, die einen gesunden Lebensstil pflegen. Viele fragen sich dann: Warum gerade ich? Eine mögliche Ursache können Medikamente sein, die eine Infektion begünstigen:
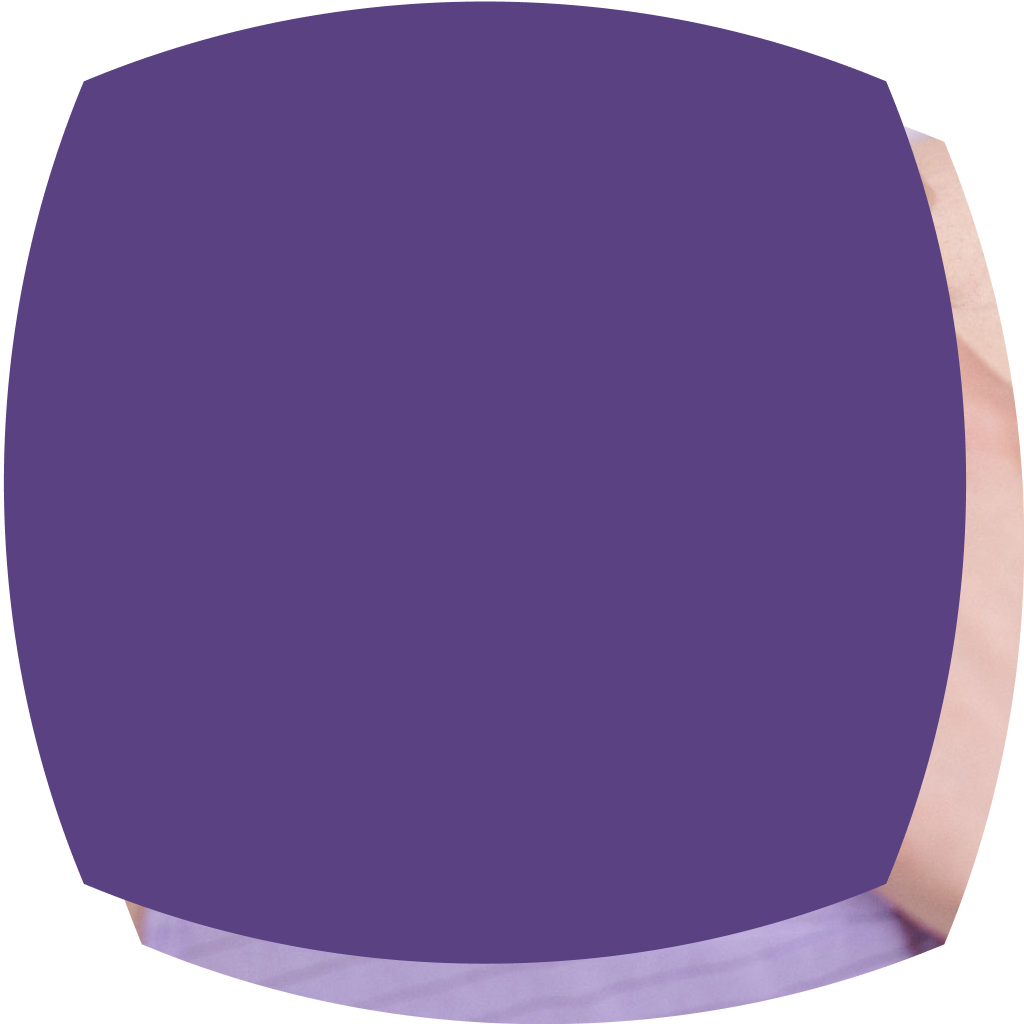
- Antirheumatika (Medikamente gegen Rheuma)
- Immunsuppressiva (z.B. Kortison)
- Chemotherapeutika (z.B. während einer Krebsbehandlung)
Typisch ist die erhöhte Anfälligkeit der vaginalen Flora durch die Einnahme von Antibiotika. Sie bekämpfen zwar die unerwünschten Bakterien. Leider töten sie aber auch viele nützliche Bakterien, wie die Milchsäurebakterien im Darm oder in der Scheide. Pilze wie Candida albicans haben es ohne den natürlichen Schutz der Vaginalflora und dem sauren Scheidenmilieu leichter und beginnen, sich rasch zu vermehren.
Je länger ein Antibiotikum angewendet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Scheidenpilzinfektion. Auch Kortison oder Medikamente gegen Rheuma können die Ausbreitung von Scheidenpilzen begünstigen, da sie immunsuppressiv wirken.
Daher empfehlen viele Ärzt:innen begleitend zur oder nach der Antibiotika-, Kortison-, oder Rheuma-Therapie die Einnahme von Präparaten zur Stabilisierung der natürlichen Darm- und Hautflora. Für die Unterstützung der natürlichen Vaginalflora ist eine Milchsäurekur über sieben Tage zu empfehlen.
Intimhygiene: die „unscheinbaren“ Scheidenpilz Ursachen

Hygiene ist selbstverständlich. Routiniert steigen wir morgens in die Dusche, greifen zu Duschgel und Seife. Wir pflegen den Intimbereich mit feuchtem Toilettenpapier oder Intimdeodorant. Stets im Glauben, richtig zu handeln und uns etwas Gutes zu tun. Falsch gedacht: Denn all diese eingespielten Hygiene-Routinen können Ursache für eine Pilzinfektion sein.
- Sowohl aggressive Seifen als auch parfümierte Intimpflegeprodukte reizen unsere empfindlichen Intimhäute und machen ihre natürliche Schutzschicht durchlässiger. Gleichermaßen beeinträchtigt der pH-Wert der Duschgele und Seifen das saure Scheidenmilieu.
- Verwendet daher für Reinigung und Pflege ausschließlich Produkte, die auf das saure Vaginalmilieu abgestimmt sind.
- Bleiben wir noch kurz unter der Dusche: Auch Waschlappen und Schwämme können einen Nährboden für Mikrokeime bilden. In diesem Zusammenhang gilt: lieber darauf verzichten oder nach einer Anwendung wechseln.
- Teilt außerdem keine Handtücher mit anderen und wascht die Textilien immer bei 60 Grad.
- Solltet ihr gerne Slipeinlagen zum Wäscheschutz tragen, achtet darauf, dass diese atmungsaktiv und parfümfrei sind, denn „falsche“ Slipeinlagen können den Luftwechsel verhindern.
Sex – eine seltene Scheidenpilz Ursache
In seltenen Fällen kann der Scheidenpilz-Erreger Candida albicans durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Grundsätzlich kann der Pilz auch im männlichen Genitalbereich siedeln. Ein Pilz allein macht allerdings noch keine Infektion. Erst bei zu starker Vermehrung kann sich ein sogenannter Penispilz (Balanitis) entwickeln und Beschwerden verursachen, was bei Männern allerdings selten passiert, da das Milieu unter der Vorhaut trockener ist.
Wird der Pilz beim Geschlechtsverkehr hin und her gereicht, spricht man vom Ping-Pong-Effekt.
Er kann beispielsweise dafür sorgen, dass sich bei geschwächter Scheidenflora eine Infektion „rätselhaft“ in die Länge zieht oder wiederkehrt – obwohl sie bereits behandelt wurde. Treten nach ungeschütztem Sex Beschwerden bei eurem Partner oder Partnerin auf oder heilt ein Scheidenpilz trotz Therapie nicht aus, solltet Ihr, euer Partner oder Partnerin sich ärztlich untersuchen und gegebenenfalls behandeln lassen.
Erfahrt in diesem Beitrag mehr über die Ansteckung von Scheidenpilz!
Ein weiterer Risikofaktor beim Sex ist der Wechsel von Anal- auf Vaginalverkehr. Auf diese Weise gelangen Darmbakterien in den Vaginalbereich, wo sie „Unheil“ anrichten können. Meidet das besser und schützt euch beim Sex mit Kondomen, wenn eure Partner:innen im Bett häufiger wechseln. Um die Heilung der Infektion nicht zu gefährden, solltet Ihr während einer Scheidenpilz-Behandlung auf Sex verzichten und in den Tagen danach besser Kondome benutzen.
Ernährung die bittersüße Scheidenpilz Ursache

Wer öfter an einer Scheidenpilzinfektion leidet, sollte auch seine Ernährung genauer unter die Lupe nehmen. Wie auch bei anderen Krankheiten, begünstigt eine nährstoff- oder vitaminarme Ernährung deren Entstehung oder andersherum: Wer sich unausgewogen ernährt, riskiert eine Schwächung des Immunsystems. Denn die immunologische Abwehr braucht ebenso wie alle anderen Körperzellen viele Vitamine, Mineral- und Nährstoffe, um einwandfrei zu arbeiten.
Eine zuckerarme Ernährung ist empfehlenswert und gesund, jedoch hat der Zuckerkonsum keinen Einfluss auf die Vaginalflora oder die Entstehung einer Scheidenpilzinfektion.
Zusammenfassend gilt: Eine ausgewogene, vitamin- und nährstoffreiche Ernährung stärkt das Immunsystem, kann jedoch einen Scheidenpilz nicht verhindern.
Scheidenpilz erfolgreich behandeln
Egal welche Ursache dahintersteckt, eine Scheidenpilzinfektion muss behandelt werden. Je eher desto besser. Zur Therapie haben sich seit Jahren die sogenannten Antimykotika mit Wirkstoffen wie Clotrimazol bestens bewährt. Clotrimazol ist sicher, wirksam und unbedenklich – auch in der Schwangerschaft. Viele Antipilz-Medikamente sind sogenannte Breitband-Antimykotika. Das heißt: Sie wirken nicht nur gegen einen, sondern gegen mehrere Pilzstämme.
KadeFungin 3 mit Clotrimazol
Idealerweise behandelt ihr eine Pilzinfektion über drei Tage mit der Kombi-Packung KadeFungin 3. KadeFungin 3 erhaltet ihr rezeptfrei in der Apotheke. Die Kombi-Packung besteht aus drei Vaginaltabletten und einer Vaginalcreme. Die Vaginaltablette führt ihr an drei aufeinanderfolgenden Tagen einmal täglich, abends vor dem Schlafengehen, mit dem beiliegenden Applikator in die Scheide ein – wenn ihr schwanger seid, nehmt statt dem Applikator den Finger. Die Creme tragt ihr dreimal täglich auf die äußeren Schamlippen sowie den Bereich zwischen Scheideneingang und After auf. Mehr zur Behandlung von Scheidenpilz erfahrt Ihr in diesem Beitrag!
Tipps für die Intimhygiene bei Scheidenpilz
Verwendet zum Reinigen des Intimbereiches nur warmes Wasser oder milde Wasch- und Pflegemittel, die einen pH-Wert weniger als fünf haben. Wascht euch einmal täglich – ausgenommen davon sind die Tage der Regelblutung oder des Wochenflusses sowie sportliche Aktivitäten. Immer erst den Bereich der Scheide waschen und danach die Analregion. Denn hier lauern Darmbakterien, die beim Wischen in die verkehrte Richtung leicht in die Vagina gelangen können. Das Gleiche gilt für das Abwischen nach dem Gang zur Toilette.
Statt synthetischer Slipeinlagen können Unterwäsche aus natürlichen Fasern oder Slipeinlagen aus Baumwolle einen leichten Ausfluss gut abfangen. Lasst außerdem die Finger von Intimdeos oder parfümierten Feuchttüchern und beachtet die Regel jeder guten Intimpflege: weniger ist mehr.
Auch mit ungünstiger Kleidung könnt ihr einen Scheidenpilz zu euch einladen. Zu knappe Hosen und synthetische Materialien schnüren eurem Intimbereich sprichwörtlich die Luft ab. Steigt zumindest bei der Wäsche auf natürliche Fasern um und tragt lockere Kleidung.
Scheidenpilz Ursachen vermeiden: die Gesundheit allgemein fördern
Um die Gesundheit so gut wie möglich zu schützen, dem Immunsystem unter die Arme zu greifen und damit auch eine Infektion mit Scheidenpilzen zu vermeiden, gibt es einige effektive Hebel. Dazu zählen:
- Ausreichend Schlaf – schlaft ungestört mindestens sechs bis acht Stunden pro Nacht.
- Vitamin- und nährstoffreiche Ernährung – esst täglich frisches Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Spart mit Zucker oder tierischem Fett und genießt Chips, Fastfood oder Alkohol in Maßen.
- Bewegung und Sport – geht zu Fuß, radelt oder macht Sport, wann immer es in euren Alltag passt. Macht Kardiotraining, Fitnessübungen, Gymnastik, tanzt oder geht einfach nur wandern. Lauft zur Arbeit oder nehmt das Fahrrad, statt das Auto oder den ÖPNV. Steigt die Treppen, statt im Aufzug zu fahren. Einfach gesagt: Bewegung tut euch und eurem Körper gut.
- Kein Stress und gute soziale Netze – ob zu viel oder überfordernde Arbeit, Sorgen, Ängste oder psychische Belastungen in Beziehungen: Befreit euch davon, wenn es geht. Dabei helfen zuverlässige sowie solide Freundschaften, manchmal ein selbstsicheres „Nein“, aber auch Entspannungstechniken wie autogenes Training oder Yoga.
Die Scheidenpilz Ursachen kennen und vorbeugen

Scheidenpilzinfektionen haben viele Ursachen. Gut, wenn Ihr die Gründe genauer kennt, so könnt Ihr wiederkehrenden Infektionen einen Riegel vorschieben. Auch wenn ein Vaginalpilz mit Clotrimazol gut und unkompliziert behandelbar ist, ist es ratsamer, ihm vorzubeugen und einige Anti-Pilz-Routinen in den Alltag zu integrieren. Mehr zu Scheidenpilz vermeiden erfahrt ihr in diesem Beitrag!
Dazu zählt ganz allgemein eine gesunde und stressfreie Lebensweise mit viel Bewegung an der frischen Luft und vitaminreiches sowie frisches Essen. Auch mit der richtigen Intimhygiene könnt ihr euch schützen. Verwendet sanfte Pflegeprodukte oder nur Wasser und wascht euch nicht zu oft. Frauen – egal welchen Alters – können ihre Vagina gelegentlich, und ganz besonders nach einer bakteriellen Vaginose oder einer Antibiotika-Therapie, mit einer Milchsäurekur verwöhnen, um die natürliche Scheidenflora zu stabilisieren. Denn ähnlich wie bei der Körperpflege, dankt es euch auch eure Vagina, wenn ihr sie gut pflegt.








